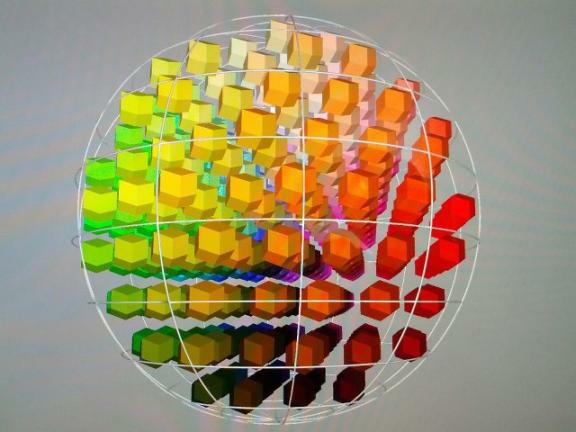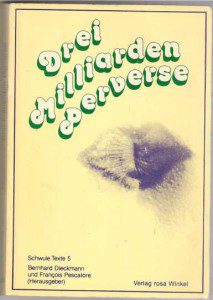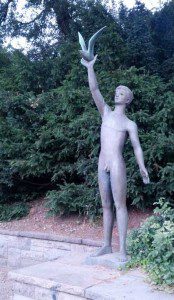Er war sein letzter Film, und sein Meisterwerk: die Verfilmung des Romans “Querelle de Brest” von Jean Genet. Der Film “Querelle” wurde 1982 gedreht und erstaufgeführt am 16. September 1982.
Rainer Werner Fassbinder, geboren am 31. Mai 1945 in Bad Wörishofen, starb am 10. Juni 1982 in München. Juliane Lorenz, Cutterin seiner letzten 14 Filme und langjährige Gefährtin (und seit 1992 alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin der in Berlin ansässigen Rainer Werner Fassbinder Foundation RWFF), fand ihn morgens um 4 Uhr tot in seiner Wohnung.
Das Leben von Rainer Werner Fassbinder wird derzeit unter der Regie von Marco Kreuzpaintner verfilmt, der zusammen mit Gerrit Hermanns auch das Drehbuch verfasst.
.
Einer der stärksten Filme von Fassbinder, der mich am meisten beeindruckt, ist sein (je nach Zählweise 41. oder 45. und) letzter Film: „Querelle„.
Der Film “Querelle” wurde 1982 in den Berliner CCC-Studios gedreht und erstaufgeführt nach Fassbinders Tod am 16. September 1982.
28 Jahre später, im Jahr 2009 kommt der Film neu heraus und in die Kinos – frisch restauriert. In die Kinos? Ja – in Frankreich, und scheinbar nur dort. Zudem erschien der Film in Frankreich am 20. Oktober 2009 auch als DVD mit umfangreichen Extras.
.
In seinem letzten Interview (mit Dieter Schidor) sprach Fassbinder von Genets Querelle als dem „Stoff, der etwa dem entspricht, den ich selber erfinden würde, wenn ich erfinden würde.„
„Bei „Querelle“ geht es um den Entwurf einer möglichen Gesellschaft, die nach aller Ekelhaftigkeit wunderbar ist. …
Homosexualität ist aber in „Querelle“ auch gar kein Thema. Das Thema ist die Identität eines Einzelnen und wie er sich diese verschafft. Das hängt damit zusammen, wie Genet sagt, daß man, um vollständig zu sein, sich selber noch einmal braucht. Darin gebe ich Genet vollkommen Recht.
Ulrich Behrens analysiert 2005 auf ‚Filmzentrale‘
„Im magischen Dreieck von Macht (Seblon, Mario), Geld (Nono, Querelle) und Sexualität (als Unterwerfungs- und Integrationsstrategie) offenbart sich Macht als Organisationsprinzip von Gesellschaft, die – ganz im Foucaultschen Sinne – weniger das Instrument einer herrschenden Klasse repräsentiert, als das Zentrum, um das sich eine ganze Gesellschaft samt ihrer Geschichte und damit auch den Mythen, die sich um diese Geschichte bilden, gruppiert. …
Die Entmachtung des weiblichen Prinzips, repräsentiert durch Lysiane, kontrastiert mit einer Suche nach Identität, die den Tod, das heißt die vollkommene Identität, permanent als Möglichkeit einbezieht.“
.
Ich kann mich gut erinnern, als ich damals 1982 in Hamburg zum ersten mal Fassbinders „Querelle“ sah. Genets 1947 geschriebenen ‚Querelle de Brest‘ hatte ich zuvor mehrfach gelesen, doch es blieb das Gefühl, den Roman nicht verstanden zu haben. Und dann. Fassbinder verfilmt Querelle. Ich ging aus dem Kino, mit dem tiefen Gefühl ‚er hat ihn verstanden‘, und – er hat ihn zuende gedacht.
.
„Jemand muss sich in die tiefsten Tiefen dieser Gesellschaft begeben, um sich für eine neue zu befreien oder sich befreien zu können. Dass jemand, der das tut, wie auch immer faszinierend ist, ist klar.“
(Rainer Werner Fassbinder in seinem letzten Interview mit Dieter Schidor)
.
Gilles: „Komisch, wie schnell wir Freunde geworden sind.„
Querelle: „Wir waren Freunde von Anfang an.„
.
Die Film-Welt des Querelle, eine Welt, in der Frauen weitestgehend außen vor sind. Selbst Lisiane, die einzige Frau mit Sprechrolle im Film, wirkt wie in einer anderen Welt.
„Lisiane stand immer mehr außerhalb des Spiels„
(off)
„du bist doch bloß eine Frau„
(Querelle, angetrunken, zu Lisiane auf die Frage „was ist mit mir“)
.
Passivität und Hingabe
„Es gibt eine männliche Passivität die so ausgeprägt ist, dass sie sich in … der absolut entspannten Erwartung des Körpers [ausdrückt], seine Rolle zu erfüllen, seinen Sinn, Lust zu geben und zu empfangen.„
(Lisiane)
„Ich weiß, dass ich dabei nichts riskiere. Es gibt absolut keine Gefühlsregung, die die Reinheit meines Spiels trübt. Dabei ist keine Leidenschaft. Es ist nur ein Spiel ohne Schwere. Zwei Männer, beide stark und vergnügt, wobei der eine davon sorglos, ohne Umstände zu machen, dem anderen seinen Hintern überlässt.„
(Nono)
.
Nein, als „Fassbinders am schwersten zugänglichen Film„, wie die Kritik damals formulierte, empfinde ich Querelle nicht. Als bewundernswertesten.
.
„Querelles Einvernehmen mit sich selbst war unzerstörbar„
.
„weil ich eine todbringende Wunden in mir habe„
(Querelle / Brad Davis)
Brad Davis starb 1991, 9 Jahre nach Fertigstellung des Films, nach langer Aids-Erkrankung an einer absichtlichen Überdosis Drogen
.
Immer noch irritierend, dass Querelle in Deutschland nicht verfügbar ist, weder für das Kino noch als Konserve (und wie gut, dass es Fassbinders Querelle in Frankreich, sogar restauriert, als DVD gibt, und zudem mit deutschem Ton).
.
Lesezeichen:
„In den Tiefen der Gesellschaft“ – Interview mit Rainer Werner Fassbinder. in: Evangelischer Filmbeobachter, Nr. 17, September 1982 (pdf)
Ulrich Behrens: „Querelle – Ein Pakt mit dem Teufel“