Am 14. Mai 1983 wurde das MHC „Magnus Hirschfeld Centrum“ in Hamburg eröffnet. Im Herbst 1982, vor 30 Jahren, wurde es geplant und seine Förderung beim Hamburger Senat beantragt.
Das Magnus Hirschfeld Centrum (MHC) in Hamburg wurde am 14. Mai 1983 (in den Räumen einer früheren Bäckerei am Borgweg) eröffnet. Heute ist es eines der wenigen noch existierenden Schwulen- und Lesben-Zentren.
Am 30. Mai 2013 feierte das Magnus Hirschfeld Centrum in Hamburg sein 30jähriges Jubiläum unter dem Motto „30 Jahre Einsatz für queere Emanzipation“.
MHC Magnus Hirschfeld Centrum : Förderungs-Antrag an den Hamburger Senat
Der von der UHA (Unabhängige Homosexuelle Alternative) sowie Intervention gestellte Antrag (60 Seiten plus Anhang) auf Anlauf- und Folgefinanzierung erläutert die Notwendigkeit eines Schwulen- und Lesbenzentrums folgendermaßen:
„Bedingt durch die fortbestehende Diskriminierung sind Homosexuelle Frauen und Männer in besonderem Maße auf umfassende Kontakte untereinander und auf gegenseitige Hilfer angewiesen. …
Die traditionellen ‚Treffpunkte‘ für Homosexuelle, die sich urwüchsig als ‚Nachtkultur‘ aus der gesellschaftlichen Stigmatisierung gleichgeschlechtlich liebender Menschen ergeben haben (Kneipen, Parks, Klappen) können diesem Bedürfnis nur in sehr eingeschränktem Maß Rechnung tragen, da sich hier verständlicherweise einseitige Umgangsformen ergeben, die lediglich bestimmte Aspekte des homosexuellen Menschen ansprechen können. Besonders deutlich treten diese Umgangsformen an jenen ‚Treffpunkten‘ hervor, die mehr oder weniger häufig Kontrollen der Polizei unterliegen (Parks, Klappen). In Folge der begonnenen Emanzipation homosexueller Bürgerinnen und Bürger hat sich das Bedürfnis nach einer Veränderung dieser Situation zunehmend entwickelt.“
In dem von Horst Parow (UHA) und Dieter Jarzombek (Intervention) unterzeichneten Antrag vom Oktober 1982 wird eine Kombination aus Kommunikations- und Beratungs-Zentrum skizziert. Wesentliche Mitstreiter waren damals auch Hans-Georg Stümke (1941 – 2002) und Hans-Georg Floß (1951 – 1993).
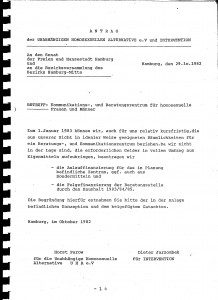

Wesentlicher Teil des Antrags war ein von Hans-Georg Floß (*1952, † 7.1.1993 an den Folgen von Aids) erstellter Bericht über den damaligen ‚Stand des Beratungsangebots für homosexuelle Männer in Hamburg‚, der wesentlich auf (s)einer 1981 an der Universität Hamburg (Fachbereich Psychologie) erstellten Diplomarbeit beruhte.
MHC : Namenspatron Magnus Hirschfeld
Bereits von Beginn an war vorgesehen, das Zentrum nach Magnus Hirschfeld zu benennen:
„Um seine Verdienste und seinen großen persönlichen Einsatz für die Verwirklichung der Menschenrechte der Homosexuellen vor 1933 zu ehren wird vorgeschlagen, der Einrichtung den Namen ‚Dr. Magnus Hirschfeld – Zentrum‘ zu geben.“
Das Magnus Hirschfeld Centrum besteht seit 1983 und bis heute, mit der UHA (Unabhängige Homosexuelle Alternative e. V.) als alleinigem Trägerverein. Es bezeichnet sich heute als ‚Hamburgs lesbisch-schwules Zentrum für Beratung, Kommunikation, Kultur und Jugend‘.
Der Verein Intervention e.V., im September 1982 von Lesben und Schwulen gemeinsam mit dem Ziel einer Beratungsstelle gegründet, war an der Gründung des MHC mit beteiligt, arbeitete jedoch bereits ab 1983 (dem Jahr der Eröffnung des MHC) eigenständig in St. Georg. Intervention e.V. „unterstützt seit 1993 fast ausschließlich und exklusiv lesbenspezifische Angebote“ (Selbstdarstellung) und ist Träger des JungLesbenZentrums und des Lesbentreffs in Hamburg.
.
An den Gesprächen im Vorfeld der Planung und Beantragung des Magnus Hirschfeld Centrums nahmen auch Vertreter anderer Hamburger Lesben- und Schwulengruppen zeitweise teil. Alle scheiterten, zogen sich zurück. Die Mitarbeit von Schwusel (Selbsthilfegruppe schwuler und lesbischer Jugendlicher im Alter bis ca. 25 Jahre) im MHC scheiterte letztlich, in meiner Erinnerung, vor allem daran, dass die UHA von ihrer dominierenden und allein entscheidenden Position nicht abweichen wollte.
Der Namens-Patron Magnus Hirschfeld war schon damals nicht unumstritten. Die Debatten um Magnus Hirschfeld führten u.a. mit dazu, dass sich das im März 1985 eröffnete (und seit Mitte 2003 nicht mehr existierende) Kölner Lesben- und Schwulen-Zentrum nach langen Debatten nicht nach Magnus Hirschfeld benannte, sondern nach einem öffentlichen Namens-Wettbewerb schlicht den Namen ‚SCHULZ‚ (für Schwulen- und Lesben-Zentrum) erhielt.
Das Magnus Hirschfeld Centrum wurde von einer einzigen dominierenden Gruppe geplant und gestaltet. Es hätte Möglichkeiten zur Einbeziehung eines breiteren Spektrums von Hamburger Lesben- und Schwulengruppen gegeben (zum Beispiel in Form des damals existierenden ‚Forum Hamburger Lesben und Schwule‘ (FHLS). Das Kölner Lesben- und Schwulen-Zentrum SCHULZ schaffte es einige Jahre später, trotz einer starken Stellung der ‚gay liberation front‘ (glf) eine Trägerstruktur zu finden (Emanzipation e.V.), die eine Einbeziehung breiter Kreise der Kölner Lesben- und Schwulenszenen ermöglichte.
.































