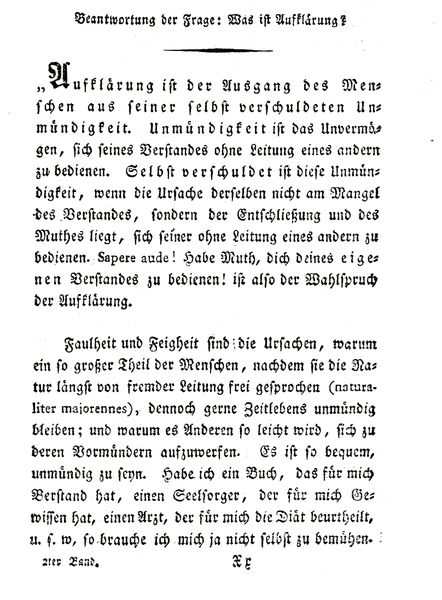„Hey.“
Ich fühle eine Hand auf meiner Schulter. Einen Arm, der sich um mich legt.
„Hey.“
Irgendjemand wischt mir Tränen aus dem Gesicht. Erschöpfte lehne ich mich an ihn. Weine. Eine Hand legt sich auf meinen Kopf.
„Ich weiß.“
Er rüttelt mich.
„Hey.“
Wieder rüttelt er mich. Wo bin ich? Leicht schlägt er mir mit der Hand auf die Wange. Ich reibe mir die Augen. Blicke in die Augen von Sylvain, einem der besten Freunde Jean-Philippes. Ich verstehe nicht. Wo bin ich? Was ist hier los?
„Hey, wir müssen langsam los.“
Los, wohin? Ich schaue mich um. Steine, überall Steine. Da hinten, die Treppe, die Kuppel. Langsam erinnere ich mich. Die Halle, diese Halle. Wir sitzen auf den Stufen des Columbariums. Keine Ahnung, wie spät es ist.
„Hey, Ulli. Wir haben dich alle gesucht. Was machst du denn.“
Ich muss lange hier gesessen haben. Versuche zu sprechen. Mehr als gurrendes Gestotter, sinnlose Laute, will nicht aus meinem Mund kommen.
„Ich weiß. Ich weiß“, höre ich Sylvain auf mein Gestammel antworten. „Ich weiß.“
Er streicht mit seiner Hand durch mein Haar. „Ich weiß. Mir geht es ja ähnlich wie dir.“
Ich sehe ihn an. Wortfetzen fallen aus meinem Mund, aber ich weiß nicht welche.
„Ich weiß“, höre ich immer wieder.
Wie beruhigend plötzlich Sylvains Stimme auf mich wirkt, wie warm sein Arm auf meiner Schulter, wie vertraut, obwohl wir uns nie sehr nahe waren. Er fasst mich, zieht mich hoch. Ohne Gegenwehr, wie willenlos folge ich seiner Bewegung.
„Wir müssen jetzt los. Die anderen sind schon vor einiger Zeit gefahren. Dominique und ich haben noch weiter hier nach dir gesucht.“ Ich sehe ihn auf die Uhr blicken.
~
Irgendwann Stunden zuvor.
Frühmorgens fährt der Zug in den Gare du Nord ein. Da drüben, in dem Café habe ich gesessen, als ich zu früh morgens ankam, damals, als ich Jean-Philippe zum ersten Mal in der Klinik besucht habe. Damals. Wie weit entfernt das klingt, dabei sind seitdem nur Monate vergangen. Ein verdammt trostloser, sorgenvoller Morgen damals. Nichts gegen das, was mir jetzt wohl bevor steht. Keine Idee was mich erwartet. Gefühl ich will das alles nicht. Möchte abhauen, fliehen, mit dem nächsten Zug zurück. Oder besser noch, zwei drei Bier und dann ab in die nächste Sauna, mir alle Sinne aus dem Leib ficken lassen. Kann man Situationen, Momente ungeschehen machen? Klar nein, und doch wünschte ich mir nichts mehr als diese Situation, diesen beschissenen Tag einfach aus der Realität tilgen zu können. Ich will nicht hier sein, ich will nicht erleben was gleich geschieht, ich will nicht dass es geschieht. Ich will nicht. Ich kann nicht.
Manisch schleppen mich meine Beine gen Metro-Station. ‚Du kannst jetzt nicht kneifen, jetzt nicht! Das bist du Jean-Philippe schuldig, das zumindest!‘, sagt eine Stimme in mir. Eine Stimme, die irgendwie die Oberhand gewinnt, mich steuert, mich in die Metro setzt, in irgendeinen Zug, mit irgendwelchen Leuten, igendwelchen Gesichtern Stimmen Launen. Irgendwann lässt die Stimme mich aussteigen machen.
Unverfrorenerweise scheint die Sonne an diesem Tag. Ungläubig tappse ich aus dem Dunkel der U-Bahn-Station, blinzele. Sonne, das ist einfach unmöglich. Die größte Frechheit. Wie kann an diesem Tag die Sonne scheinen? Deine Sonne? Oder bist du das? Bist du schon da oben, in der Sonne, schaust zu, was wir hier Absonderliches treiben?
Die Trauerhalle ist nicht zu übersehen. Vor Jahren bin ich auf dem ‚Père Lachâise‘ mit Frank spazieren gegangen, geschlendert auf der Suche nach den Gräbern von Jimmy Morrison, Edith Piaf und Co. Heute weiß ich nicht was ich hier will, was ich hier soll, und bin doch nur zu dem einen Zweck hier. Zwei drei Leute nicken mir zu. Ich fliehe schnell in die Trauerhalle. Jetzt bloß nicht mit irgend jemandem reden müssen.
Dunkel, warm, seltsam feucht-moderig ist die Halle. Und viel größer als erwartet. Manche Stadt hat sowas nicht als Theater, geht es mir durch den Kopf. Eine Art Bühne vorne, Blumenschmuck, ein Pult für einen Redner. Reihen von Stühlen. Vorne sehe ich Syriac mit einigen Freunden. Er bemerkt mich nicht. Hinten, dort ist ein Balkon, beinahe wie in einem dieser alten französischen Kinosäle. Ich verkrieche mich dort, in einer der oberen Reihen. Erst jetzt sehe ich mitten auf der Bühne, ein wenig im Hintergrund, den Sarg, in dem du jetzt liegst. Will dir nahe sein, und doch so weit weg wie irgend möglich von dem, was hier geschieht. Kaum jemand sitzt hier oben, unten hingegen drängen sich langsam Menschen in die Reihen. Annie sitzt ganz vorne, neben Syriac, bei ihr Jean-Philippes kleiner Bruder. Immer mehr Menschen kommen. Was wollen die hier, kannten die alle Jean-Philippe? Könnt ich mich nur irgendwo allein verkriechen.
Ein Gong, fast wie aus dem Off eines großen alten Kinos. Nein, kein Vorhang öffnet sich, kein Film. Ein orange gekleideter Mensch den ich nicht kenne ist auf die Bühne gegangen, hat wortlos einen kleinen messingfarbenen Gong geschlagen. Stille. Musik vom Band. Irgendwann reden irgendwelche Menschen in fremder Sprache salbungsvolle Worte, die ich kaum verstehe. Dicke Nebelschwaden ziehen vor meinen Verstand, dunkel schwant mir noch, dass das hier eine Trauerfeier nach dem Ritus des buddhistischen Ordens sein wird, dem du dich zuletzt so nahe fühltest. Die Neben werden dicker, dunkler, dräuender. Nacht, ich versinke in tiefschwarzer beängstigender Nacht. Nichts mehr, nicht einmal Gedanken. Nur solch ein seltsamer, Ekel erregender Geruch. Und Leere, kalte schwarze Leere. Wie festgeklebt sitze ich hier, auf immer gefangen in dieser schwarzen klebrigen Leere. Kein Wille kann meinen Augen Ohren Beinen Befehl geben sich abzuwenden. Wie schwarz-grauer Schleim dringt kalte klebrige Leere überall hin, verklebt Augen Ohren Hände.
Irgendwie dringt durch all das gewaltige Nichts ein seltsames Gongen an mein Ohr. Noch einmal. Ein wenig lichten sich die grauen Nebelschwaden. Ich sehe Menschen dort unten zurück zu ihren Plätzen gehen, die letzten werfen gerade ein Räucherstäbchen in eine bereit gestellte Schale auf der Bühne. Noch ein Gong. Wie in einem schlechten Film senkt sich plötzlich langsam der Sarg ab. Verschwindet irgendwo in den Tiefen der Bühne. Fremdartige Musik füllt die schwarze Stille. Einer der Orangegewandeten beginnt noch fremdartiger klingende Mantras zu beten. Riten. Meditationen. Ich versinke tief im ewigen schwarzen Schlund.
Wieder so ein seltsamer Gong. Wie viel Zeit ist vergangen? Bin ich immer noch hier? Ein kleines, schwarz gekleidetes Männchen kommt rechts neben der Bühne aus dem Vorhang getreten. Geht hinunter, zur ersten Reihe. Sieht sich kurz ratlos um, bis Syriac aufsteht. Einen seltsamen Karton entgegen nimmt, den ihm der Mann reicht.
Ich sehe Menschen dort unten aufstehen, dem Ausgang zustreben. Das Licht auf der Bühne wird gelöscht. Irgendwie folge ich dieser Herde. Die Treppe hinunter, raus, nur raus hier, hämmert es in meinem Kopf. Wie betäubt trotte ich dem Ausgang entgegen. Kein Laut. Keine Stimme. Kein Geräusch. Unendliche Kälte. Mit wird schwindelig. Filmriss.
~
Dominique lenkt den Wagen durch den dichten Pariser Verkehr. Ich blicke durch die Scheiben, sehe nichts was Sinn macht. Dichte milchig-weiße Nebelschwaden hängen tief in meinem Kopf. Irgendwann stolpere ich hinter Dominique und Sylvain aus dem Fahrstuhl. 13. Etage, 19. Arrondissement.
„Da bist du ja endlich, wir haben uns schon Sorgen gemacht.“ Liebevoll nimmt Syriac mich lange in den Arm, gibt mir einen Kuss. Jean-Philippe steht in seiner Urne auf der Fensterbank, neben der Balkontür. Umrahmt von zwei Blumenarrangements. Die Sonne scheint. Auf dem Boden liegt der Pappkarton.
Etwa 20 Gäste mögen da sein, ich erkenne Annie, die zu mir herüber nickt, ihren kleineren Sohn im Arm. Syriac drückt mir einen Teller in die Hand. „Hier, du musst jetzt was essen.“ Er sieht mich bestimmt an. Wie ferngesteuert greife ich nach irgendwelchen Dingen, die da auf Tabletts auf dem Tisch liegen. Der zähe klebrige Alptraum geht weiter. Ich verkrieche mich in eine Ecke, hinten in dem Zimmer, das so oft in den letzten Monaten mein Zimmer gewesen ist. Nein, auch hier mag ich jetzt nicht sein. Verkriechen. Alleinsein. Nur weg hier.
„Entschuldige bitte, aber ich möchte jetzt lieber allein sein. Und langsam muss ich ja auch zurück nach Köln, mein Zug …“.
Immerhin, mein Verstand funktioniert scheinbar wieder so weit, dass ich mich in sinnvollen Worten ausdrücken kann.
„Ich weiß.“
Syriac sieht mich liebevoll an.
„Sylvain fährt dich. Damit du auch wirklich am Bahnhof ankommst.“
Wir geben uns Küsse auf die Wangen, nehmen uns so intensiv in den Arm als würden wir uns auf immer voneinander verabschieden.
„Pass auf dich auf. Und – danke nochmal für alles!“
„Gerne“, kann ich noch antworten, bevor sich die Fahrstuhltür schließt.
Eine unsichtbare Regie übernimmt wieder. Tiefgarage Wagen Bahnhof Zug. Fremde Menschen Bewegung Trostlosigkeit Leere. Irgendwann komme ich in unserer Wohnung in Köln wieder zu mir.
~
Einige Tage mit dir
1. Conti & co.
2. Sternenhimmel
3. Fühlt euch wie zuhause
4. Tristesse in Pigalle
5. Allooo, isch Jean-Philippe Muutti
6. Le Vaudeville
7. Wo bin ich?