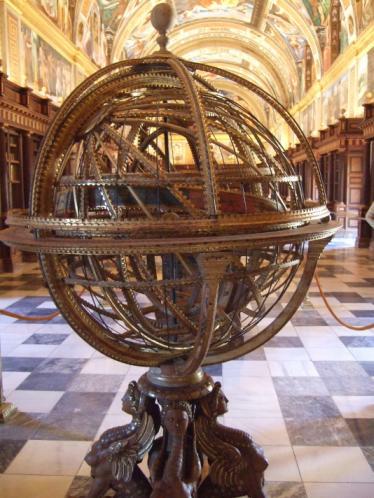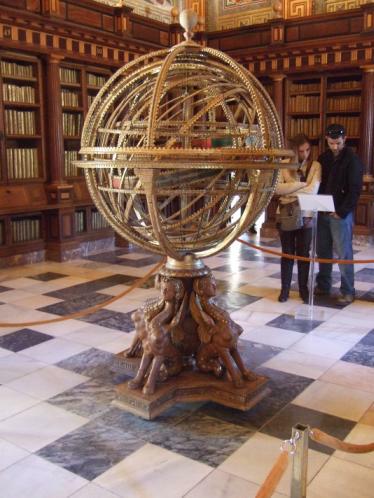Ulli Würdemann (52) hat Aids in allen Facetten miterlebt: die ersten Meldungen in den 1980ern, HIV-Diagnose 1986, seither Engagement in der Aidshilfe. 1996 totgesagt von den Ärzten, rettet ihn einer der ersten Proteasehemmer. Derzeit renoviert er mit seinem Mann Frank das Häuschen seiner Schwiegermutter am Stadtrand von Hamburg. Dort wollen die beiden zusammen alt werden. Auf der Baustelle sprach er mit aidshilfe.de
Ulli, weißt du noch, wann du zum ersten Mal von Aids gehört hast?
Das war 1982 oder 1983, eine kleine Meldung in „Vermischtes“ der Süddeutschen Zeitung. Meine Reaktion war damals: Da sterben in Amerika ein paar Schwule an Krebs – was hat das mit mir zu tun? Irgendwann kam dann die Bezeichnung „Schwulenkrebs“ auf, HIV galt ja erst mal als reine Schwulenkrankheit. Seitdem war Sex für mich wieder mit Angst besetzt. Schon kurze Zeit später war es beinahe wie im Krieg: Fast jede Woche starben Freunde, Lover, Weggefährten. Ich dachte mir: Jetzt haben wir uns mit Müh und Not eine so große Freiheit erkämpft, auch eine große sexuelle Freiheit – und das nehmen sie uns nun alles weg!
Was genau drohte, verloren zu gehen?
In der Zeit vor Aids hatten wir ein „Ethos des Experimentierens“. Ich probierte damals wohl fast alles aus, wovon ich gehört und wozu ich Lust hatte. Schlimmeres als einen Tripper oder eine Syphilis gab es ja nicht. Wir erprobten die verschiedensten Lebensformen, zum Beispiel, was das Zusammenleben angeht. Dieses Ethos ist mit Aids den Bach runtergegangen. Heute gibt es relativ wenige Lebensstile, die unter uns Schwulen noch als gesellschaftlich konform gelten: irgendwo zwischen Safer Sex und Lebenspartnerschaft. Das empfinde ich als Rückschritt.
Wann hast du erfahren, dass du positiv bist?
Ich bin vor 25 Jahren gegen meinen Willen getestet worden. Mein Hausarzt meinte aus vermeintlicher Fürsorge, er müsse mal nachschauen, weil ich in diesem Jahr meine dritte Mandelentzündung hatte.
Wie bist du mit der Diagnose umgegangen?
Nach meinen ersten Erfahrungen mit Aidshilfe und Selbsthilfegruppen stellte ich es für mich beiseite. Ich wusste: Ich hab’s. Man konnte damals eh nichts machen. Ich ließ nur alle zwei Jahre meine Blutwerte checken, das war’s. Damals machte ich Karriere, kümmerte mich um mein Fortkommen. Das war eine Umgangsweise, die in mein Leben reingepasst hat. Für viele Positive ist das auch heute so: Verdrängung kann zu bestimmten Zeiten okay sein.
1995 und 1996 warst du dann wochenlang im Krankenhaus …
… wegen mehrerer Lungenentzündungen und einer Antibiotika-Allergie, die zu einem lebensbedrohlichen Lyell-Syndrom geführt hatte. Meine Haut warf große, entzündete Blasen und löste sich von meinen Beinen und Fußsohlen ab. Mein Immunsystem war völlig kaputt. Es war wirklich knapp bei mir. Es gab keine HIV-Medikamente mehr, die bei mir wirkten. Im Frühjahr 1996 sagte dann mein Arzt zu mir: Ich kann leider nichts mehr für dich tun. Ich spritz dich mit Cortison für zwei Wochen fit. Guck zu, dass du mit deinem Mann noch mal einen schönen Urlaub machst.
Hast du seinen Rat befolgt?
Ja, wir haben eine Kreuzfahrt im Mittelmeer gemacht und waren danach noch eine Woche in der Türkei, in einem Hotel direkt am Strand.
Wie ging es weiter?
Nach unserer Rückkehr wechselte ich die Klinik und kam zu einem tollen Arzt. Der hat sich dahintergeklemmt. Zuvor hatte ich selbst schon rausgefunden, dass in den USA gerade ein neues Medikament erprobt wurde: Crixivan, einer der ersten Proteasehemmer. Aber in eine Studie in Deutschland kam ich nicht rein, weil es mir schon zu schlecht ging. Mein Tod hätte den Forschern die Statistik versaut.
Wie bist du trotzdem an das Medikament rangekommen?
Mein Arzt besorgte es mir als Import, sobald es in den USA zugelassen war. Meine private Krankenkasse wollte das anfangs nicht zahlen. Sie übernahm die Kosten erst, nachdem Tex Weber von „Projekt Information“ – ihm ging es genauso schlecht wie mir – und ich beim Vorstand der Versicherung Druck gemacht hatten.
Crixivan hat dir das Leben gerettet.
Ja, schon nach drei Wochen hatte sich mein Befinden verbessert, und nach einiger Zeit zogen auch meine Blutwerte nach. Aber das Mittel hätte keinen Tag später kommen dürfen.
Als du wieder hoffen durftest, was waren deine ersten Ideen?
Ich glaube, ein toller Urlaub – Aquitaine oder Bretagne. Das ist eine sehr raue Landschaft, sie kommt meinem norddeutschen Naturell entgegen. Ich mag Frankreich und die Franzosen sehr. Sie haben schöne Strände und machen guten Sex (lacht). Das ist ein Klischee, aber es ist wirklich so.
Ab wann hast du es gewagt, wieder in die Zukunft zu planen?
Früher war ich ein Mensch, der weit vorausgeplant hat. Als Frank und ich uns kennenlernten, hatten wir beide schon Vorstellungen davon, wie unser Lebensweg aussehen könnte: ein Häuschen im Grünen, später vielleicht ein Umzug nach Südfrankreich, weil es dort wärmer ist. All das warf dieses Scheißvirus über den Haufen. Damals wurde mein gedanklicher Horizont immer enger. Heute fände ich es schick, wenn ich 70 Jahre alt würde. Aber ich plane nicht mehr so lange im Voraus. Gerade stecken wir viel Zeit und Energie in unser Haus, wo wir es uns gemütlich machen wollen. Aber sollten wir in einigen Jahren feststellen, dass das Haus zu klein oder Hamburg nicht unsere Stadt ist, dann machen wir halt was anderes! Wir planen viel flexibler als früher.
Was hat dir geholfen, die schwere Zeit durchzustehen?
Mein Mann, seine Mutter, mein bester Freund und natürlich mein Arzt. Ohne sie hätte ich gar nicht solange durchgehalten, bis die Pillen aus USA angekommen waren. Aber auch die Tatsache, dass ich mich immer selbst um mein Überleben gekümmert habe. Als ich merkte, dass meine Ärzte an Grenzen kamen und ich immer kränker wurde, fing ich an, Fachzeitschriften zu lesen und zu Kongressen zu fahren. Damals merkte ich, dass das auch andere interessiert. Deshalb machte ich selbst Veranstaltungen, zum Beispiel über neue Therapieansätze oder das Verhältnis zwischen Arzt und Patient.
Viele HIV-Patienten waren in den 90er Jahren besser informiert als ihre Ärzte.
Nicht unbedingt besser informiert, aber sehr gut. Es war und ist wichtig, informiert zu sein. Ein Patient sollte wissen, was Nebenwirkungen sind, und sollte kritisch nachfragen können. Nur so kann er zusammen mit dem Arzt eine gute Entscheidung treffen und sie dann auch richtig umsetzen.
Meinst du, die meisten HIV-Patienten machen das so?
Nein, aber die medizinischen Realitäten haben sich ja auch verändert. Bald stehen 30 verschiedene HIV-Medikamente zur Auswahl. Da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Wer heute mit seiner Therapie anfängt, muss pro Tag vielleicht nur eine Pille schlucken. Patienten haben deshalb oft nicht den Bedarf, sich groß zu informieren. Aber später wird es dann schwierig, wenn zusätzliche Pillen kommen, wenn Resistenzen oder Nebenwirkungen wie Durchfälle auftreten.
Du lebst seit 29 Jahren mit deinem HIV-negativen Mann zusammen. Hast du manchmal noch Angst, Frank anzustecken?
Nein. Ich kann mich zwar an die ersten Zeiten erinnern, als wir uns fragten, ob wir dieselbe Zahnbürste benutzen dürfen. Aber solche Sorgen konnten uns die Ärzte schnell nehmen. Welche Alternative hätten wir denn gehabt? Wenn man weiß, dass man zusammen sein will, dann macht das keine Angst. Die Angst war eher: Was ist, wenn ich vor Frank sterbe?
Wenn du zurückblickst: hatten deine schlimmen Erfahrungen auch etwas Gutes?
Na klar, man wächst daran. Ich musste mich sehr früh mit Krankheit und Leid auseinandersetzen. Das war später hilfreich für mich. Ein Beispiel: Als meine Mutter an Krebs erkrankte, konnte ich mit ihr, aber auch mit ihrem Arzt umgehen. Ich hatte eine Ahnung, dass ich sie so annehmen musste, wie sie nun mal war. Bei ihr war es der klassische Fall: Jemand stirbt in ein paar Wochen, aber bekommt keine Morphiumpflaster gegen die Schmerzen, weil die süchtig machen könnten. Auf solche Situationen war ich damals vorbereitet: von den Fakten her, aber auch vom emotionalen Umgang damit.
Wie wichtig ist ein offener Umgang mit HIV?
Was das angeht, habe ich alles durch: vom Verdrängen übers Leugnen bis hin zum offensiven Umgang damit. Inzwischen ist das eine Selbstverständlichkeit für mich. Es gibt nur noch ganz wenige Situationen, wo ich es nicht sage.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Wenn ich anonymen Sex habe. Dann schaue ich, dass ich mein Verhalten vor mir und dem anderen verantworten kann. Aber ich muss nicht immer sagen, hallo, ich bin positiv. Oft kommt es sonst nicht zum Sex, sondern zu einer Fluchtreaktion oder zu einem Beratungsgespräch, und das ist in dem Moment von beiden Seiten nicht beabsichtigt. Auch in anderen Situationen erzähle ich es nicht ungefragt. Aber wenn es jemand wissen will, dann sage ich es. Auf Versteckspiele habe ich keine Lust mehr.
Hast du inzwischen Routine in Sachen „positives Coming-out“?
Mir hat es damals sicher geholfen, dass ich vorher schon mein schwules Coming-out hatte. Ich wusste ungefähr, wem ich es erzähle und wie ich es sage, dass ich positiv bin – bei Freunden, Lovern und am Arbeitsplatz. Aber die Angst vor den Reaktionen kommt immer wieder mal. Ich glaube nicht, dass man da eine Routine entwickeln kann.
Interview: Philip Eicker
.
DAH-Blog 08.06.2011: 30 Jahre HIV – „Das Mittel hätte keinen Tag später kommen dürfen“
Das Interview erschien in gekürzter Form auch in Hinnerk 12/2011
.