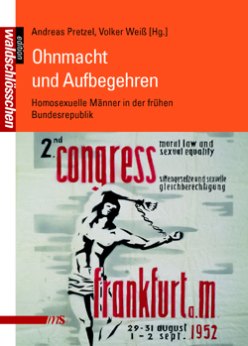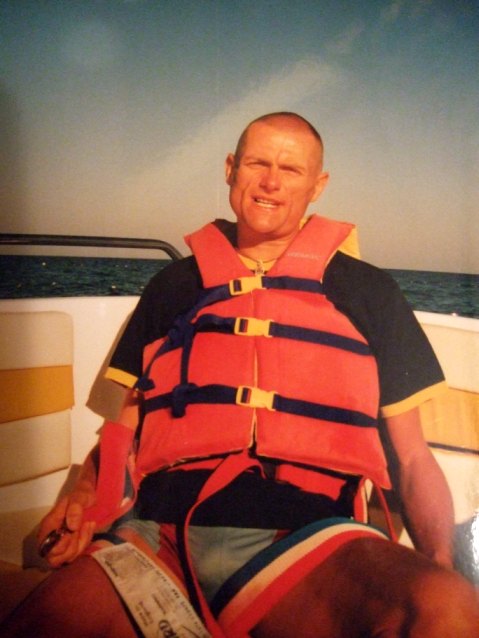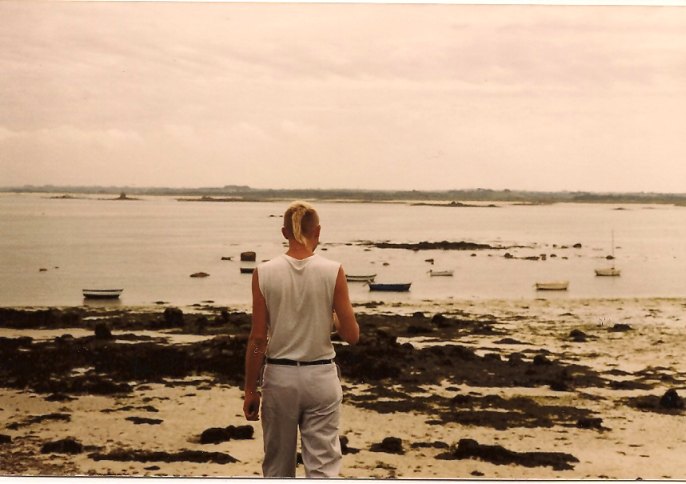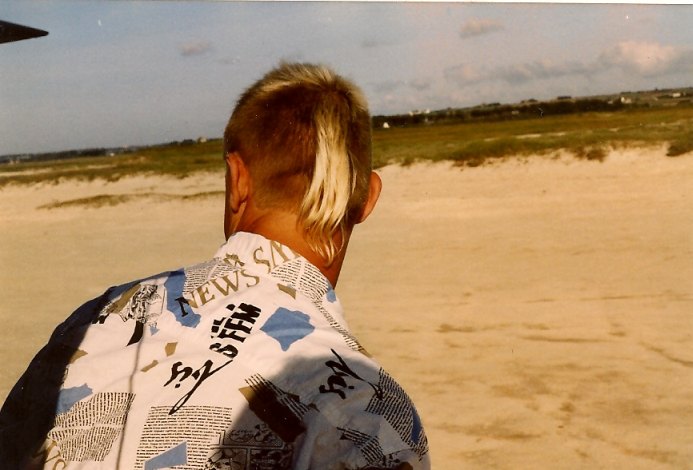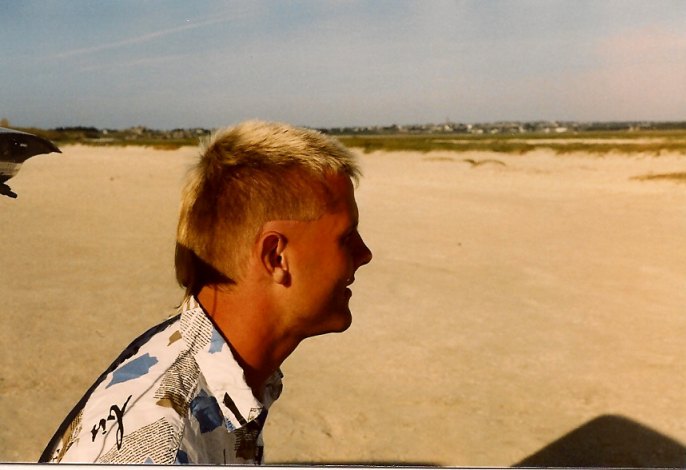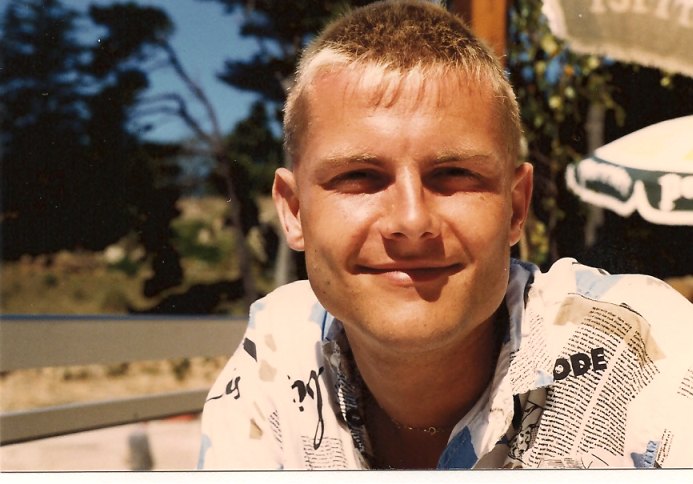In Frankreich hat jüngst der Nationale Aids-Rat CNS eine positive Empfehlung zum HIV Heimtest gegeben, kurz darauf hat auch der Ethik-Rat CCNE sich positiv zum HIV Heimtest geäußert [1]. In Deutschland wird bisher kaum breiter über HIV Selbsttests debattiert. Das folgende Interview hat das Blog ‚Immunantwort‘ mit mir geführt (dort veröffentlicht am 29.03.2013: Schluß mit Angst: Schöner testen Zuhause? (Interview)):
.
Immunantwort: Meine Geschichte der HIV-Tests verlief abenteuerlich. Meine ersten Tests kamen ziemlich unvermittelt und schlecht begleitet beim Hautarzt in Potsdam zustande. Zum Glück waren die Resultate damals alle negativ. Mein positiver Test, den ich von vornherein als positiv erwartete, fand dann im sicheren Setting einer HIV-Schwerpunktpraxis in Berlin statt. Ich war entspannt, denn ich hatte meine Ängste gegenüber HIV in der Zwischenzeit abgebaut. Trotzdem mag ich mir gar nicht vorstellen, wie Menschen reagieren die, erfüllt von der Angst vor Stigmatisierung, allein Zuhause mit zittrigen Händen ihren HIV-Test veranstalten. Das kann doch nicht gut gehen, oder?
Ulli Würdemann: Meine Test-Geschichte verlief ebenfalls abenteuerlich, wenn auch auf andere Weise und zu einer anderen Zeit. Ich wurde ohne mein Wissen (und gegen meinen erklärten Willen) auf HIV getestet. Damals gab es keinerlei Medikamente – ‘es’ zu wissen, darin sah ich keinerlei praktischen Nutzen für mich.
Ja, diese ‘zittrigen Hände’, angsterfüllt nicht nur vor Stigmatisierung sondern auch vor möglichen medizinischen wie auch biographischen Folgen im stillen Kämmerlein einen Test machen – das war immer ein starkes Argument gegen den HIV-Heimtest. Und es ist ja auch weiterhin zu berücksichtigen. HIV-positiv zu sein und dies zu wissen ist auch heute mit dem Risiko von Diskriminierung und Stigmatisierung verbunden. Und HIV-Therapie ist immer noch kein Zuckerschlecken. Deswegen ist ein HIV-Test, der in einen Beratungs- und ggf. Betreuungs-Kontext eingebunden ist, sicher eine gute Sache.
Aber vielleicht kann die Möglichkeit, einen Test auch selbst zuhause machen zu können, inzwischen eine sinnvolle Ergänzung sein?
Es geht ja nicht um Alternativen, sondern um eine weitere, komplementäre Möglichkeit. Vielleicht könnte dann eine Aufgabe von Prävention auch sein klarzumachen, dass eher ängstliche und HIV-unerfahrene Menschen in einer Beratungsstelle besser aufgehoben sind, während andere, die vielleicht auch schon Informationen zu HIV haben, mit einem Heimtest eine weitere praktikable Möglichkeit erhalten.
Immunantwort: Wo siehst Du die Vorteile und Chancen des Heimtest? Auch gegenüber der traditionellen Test-Infrastruktur?
Ein wesentlicher Vorteil: ein Heimtest ist (je nach Vertriebsweg) völlig anonym möglich. Es gibt immer noch viele Menschen, auch viele männerfickende Männer, die aus welchen Gründen auch immer nicht ‘out’ sind, oftmals auch nicht in eine Beratungsstelle, Gesundheitsamt oder Aidshilfe gehen würden – und es vorziehen sich zunächst einmal diskret und anonym Klarheit zu verschaffen. Deswegen werden in Frankreich auch verschiedene Vertriebswege für Heimtests erwogen, von Apotheken über Beratungsgruppen bis zum Internet.
Gerade die Aktivisten von Warning in Frankreich und Belgien betonen zudem immer wieder, ein selbst anwendbarer HIV-Heimtest stärke die Autonomie des Einzelnen, gerade im sensiblen Gesundheitsbereich. Autonomie werde zwar auch heute postuliert, bleibe aber doch Chimäre, da HIV-Tests bisher immer unter Aufsicht von Gesundheits-Profis stattfinden. Zukünftig könne jeder Anwender selbst aktiv Handelnder werden – auch im Bemühen, die HIV-Epidemie zu beenden. Und jeder könne zudem dabei gleichzeitig seine Privatsphäre wie auch seine Anonymität wahren.
Ein weiteres Argument ist ein ganz pragmatisches: HIV-Heimtests sind ja jetzt schon verfügbar, wenn auch nicht zugelassen: sie werden z.B. im Internet angeboten – und auch gekauft. Oft wird vor Test zweifelhafter Qualität gewarnt. Ist es da vielleicht besser, Tests kontrollierter Qualität in kontrollierten Settings verfügbar zu machen, als Test zweifelhafter Qualität und Herkunft?
Immunantwort: Was wird der Heimtest NICHT leisten können?
Hundert Prozent Sicherheit. Denn – auch Heimtests sind nicht zu 100% zuverlässig, sowohl die Tests selbst können (in seltenen Fällen) ein fehlerhaftes Ergebnis bringen (in beide Richtungen, falsch positiv oder falsch negativ), als auch die Anwendung kann fehlerhaft sein. Und es bleibt auch mit Heimtests das ‘diagnostische Fenster’, der Zeitraum zwischen Infektion und der Möglichkeit, diese nachweisen zu können.
Und Beratung – die kann kein Test ersetzen. Wie gehe ich mit dem Testergebnis um, egal wie es ausfällt? Welche Konsequenzen ziehe ich, auch und gerade für mein Sex-Leben? Kein Beipackzettel (wie jetzt in Frankreich geplant) wird das leisten können – hier wird weiterhin persönliche Beratung erforderlich und sinnvoll sein.
In der Frage ‘was heißt das für mein Sexleben’ liegt auch eines der Probleme des Heimtests: das Risiko besteht, dass er zum ‘schnellen HIV-Check vor dem Sex ohne Kondom’ verwendet wird. Aber genau diese Aussage kann er nicht sicher treffen.
Aus Sicht von Aidshilfen wie auch Gesundheitswesen wäre zudem zu bedenken, dass HIV-Heimtests möglicherweise zu einer weiteren Biomedikalisierung der HIV-Prävention führen können, zulasten sozialwissenschaftlicher Ansätze (mit denen wir ja viele Erfolge erzielt haben).
Immunantwort: Woher kommt der Sinneswandel in Frankreich? Vor einigen Jahren war die Front gegen den Heimtest doch noch absolut geschlossen
Zunächst: in Frankreich (wie übrigens auch in Belgien, wo derzeit eine ähnliche Debatte zum HIV-Heimtest läuft) ist die epidemiologische Situation eine andere als bei uns. Die HIV-Inzidenz (Zahl der neu diagnostizierten HIV-Infektionen pro Jahr und pro 100.000 Einwohner) lag in Frankreich in den letzten Jahren bei durchschnittlich 8,5 HIV-Neudiagnosen pro 100.000 Einwohner, in Deutschland bei 3,5 (und in Belgien sogar bei 10,5 bis 11). Ähnliches bei den Zahlen der an den Folgen von Aids Verstorbenen: während in Frankreich 2010 1,5 Aids-Tote pro 100.000 Einwohner verzeichnet wurden, lag dieser Wert in Deutschland bei 0,5 (und in Belgien bei 0,8). Der Handlungsdruck ist in Frankreich (wie in Belgien) vermutlich ein ganz anderer als bei uns.
Dann, die Tests sind besser geworden, sowohl was die Zuverlässigkeit des Ergebnisses angeht, als auch die Anwendbarkeit. Inzwischen gibt es auch Tests, die einfach mit einer Speichelprobe funktionieren und ziemlich schnell ein Ergebnis liefern.
Hinzu kommt, dass sich in Frankreich (wie auch in Belgien) eine neue Generation von Aktivisten engagiert und insbesondere in der multinationalen Gruppe Warning organisiert. HIV-Positive und HIV-Negative, die ‘mit HIV groß geworden sind’, andererseits aber nicht mehr den heutigen Umgang mit HIV und HIV-Positiven hinnehmen wollen. In Frankreich heißt das ganz konkret: sowohl die Aidshifen (Aides) als auch die bisher sehr stark auf Kondome fixierten Aktivisten von ACT UP Paris haben Konkurrenz bekommen, haben nicht mehr das Monopol für Betroffene zu sprechen. Gerade Warning hat spätestens seit der XIX. Welt-Aids-Konferenz in Washington das Thema HIV-Heimtest in Frankreich (ebenso wie in Belgien) sehr stark gepusht. Das Votum des Nationalen Aids-Rats geht nicht zuletzt auf Druck zurück, den Warning auf die Gesundheitsministerin ausgeübt hat.
Immunantwort: Wie schätzt Du die Chancen für eine Zulassung des Heimtests in Frankreich heute ein?
Der Nationale Aids-Rat Frankreichs (CNS), der auf Bitte der Ministerin für Gesundheit und Soziales vom August 2012 aktiv wurde, hat am 22. März seine Empfehlung zur Zulassung von HIV-Heimtests in Frankreich publiziert, am 25. März hat der Ethik-Rat (CCNE) ein positives Votum zum HIV Heimtest bekannt gegeben.
Neben diesen beiden die französische Regierung beratenden Gremien fordern inzwischen auch viele Aids-Organisationen von der französischen Aidshilfe Aides über die Aktivisten von ACT UP und die Positiven- und Gesundheits-Gruppe Warning die Zulassung von HIV-Heimtests. Ich rechne einer baldigen Entscheidung der Gesundheitsministerin Marisol Touraine. Allerdings sind dann noch praktische Fragen zu klären, wie die erforderliche ‘CE-Kennzeichnung’, so dass es bis zur echten Verfügbarkeit noch ein wenig dauern könnte. [1]
Immunantwort: In wie weit sind uns die Franzosen in ihrer Diskussion voraus?
Im ‘voraus’ läge ja eine Wertung 😉
In Frankreich ebenso wie in Belgien ist eine Debatte angestossen darüber, wie will die Gesellschaft mit HIV leben, und welcher Werkzeuge bedient sie sich dabei. Auch in Frankreich nehmen an diesen Debatten nicht so viele Schwule teil, wie man angesichts der epidemiologischen Daten vielleicht wünschen könnte – aber ich habe den Eindruck mehr als hier in Deutschland. Das empfinde ich tatsächlich als ‘uns voraus sein’ – dass Debatten nicht nur in Insider-Kreisen wie in Aidshilfen oder unter manchen HIV-Positiven stattfinden, sondern offen, unter breiter Beteiligung.
In Frankreich wird der Autonomie des Einzelnen wesentlich mehr Bedeutung, auch in der öffentlichen Debatte, beigemessen. Diese Bedeutung der Autonomie kommt auch in der Sprache zum Ausdruck: während wir von ‘HIV-Heimtest’ sprechen, sagen Franzosen ‘HIV-Selbsttest’ (autotest VIH). Auch diesen Gedanken der Stärkung der Autonomie finde ich anregend für Debatten hierzulande.
Immunantwort: Wie verlaufen hier in Deutschland eigentlich die Diskussionslinien beim Heimtest? Wer hält welche Standpunkte?
Gibt es in Deutschland Diskussionen dazu? Hin und wieder (wie zuletzt als in den USA der HIV-Heimtest zugelassen wurde) äußert sich die Deutsche Aids-Hilfe, oder eine Bundeseinrichtung warnt vor Tests aus dem Internet. Aber eine breite Debatte zum Heimtest, in schwulen Szenen? Habe ich bisher hier nicht wahrgenommen. Manchmal scheint mir, in schwulen Szenen wird dem Thema HIV (wie auch Leben mit HIV) eher gelangweiltes Desinteresse entgegen gebracht.
Die Zeiten haben sich verändert. HIV hat sich verändert. Deswegen: zunächst braucht es meiner Meinung nach eine offene (und nicht nur verdeckte) Debatte über HIV-Heimtests bei uns, in und außerhalb von Aidshilfen. Und auch in schwulen Szenen (die ja immer noch am stärksten von HIV betroffen sind). Wir müssen als Schwule doch ein eigenes Interesse haben, dass sich nicht immer noch viele Hundert von uns jährlich mit HIV infizieren? Stört es uns nicht, dass immer noch viele mit HIV infizierte Menschen erst spät Zugang zu Therapie haben – weil sie nicht von ihrer Infektion wissen? Und wenn wir Positive selbst feststellen, dass das Aids der 1980er und 1990er Jahre nicht mehr das heutige ist, dass Leben mit HIV heute entspannter sein kann – vielleicht können wir dann auch überlegen, mit dem Thema HIV-Heimtest entspannter umzugehen? Und Nutzen und Risiken des HIV-Heimtest anders abwägen als in früheren Jahren?
Immunantwort: Der Heimtest, der in Deutschland offiziell zugelassen ist, sieht idealerweise wie aus? Und wer vertreibt und bezahlt ihn?
Derzeit ist es wohl zu früh, das zu sagen. Und auch, ob und für wen HIV-Heimtests überhaupt bei uns eine sinnvolle Ergänzung im ‘Köcher der Prävention’ sein können. Aber ich denke es ist an der Zeit, unaufgeregt eine breite und offene Debatte über HIV-Selbsttests zu führen.
.
Aktualisierung
[1] Frankreichs Gesundheitsministerin Touraine hat am Freitag 05.04.2013 das für die Zulassung erforderliche Bewertungsverfahren eingeleitet.
.
siehe auch
alivenkickin 10.04.2013: HIV Selbsttest? Wieviel Selbstbewußtsein und Eigenverantwortung darf s denn sein?
.